Lebendige Erde 5/2002:
Editorial
Wiesen, Weiden, Wahlen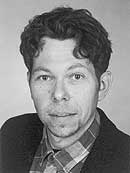
Gleich vorneweg: der Schwerpunkt unseres Heftes "Grün-land" muss nicht
als Wahlempfehlung gedeutet werden. Dennoch entscheiden diese Wahlen
auch, ob die Agrarwende weiter geht, oder ob eine überkommene Art der
Landwirtschaft nun noch mit Gentechnik verteidigt wird, gegen die Interessen
von Verbrauchern und Landwirten, die zu mehr als 70% die grüne Gentechnik
ablehnen.
Das besondere der Wiese ist das Licht - dem Wanderer, der aus dem Walde
tritt, ist das der erste Eindruck. Waren Lichtungen in der Vegetation
Mitteleuropas ursprünglich auf Auen, Moore und Hochflächen beschränkt,
hat der Mensch mit der Zeit eine vielfältige Kulturlandschaft durch
Rodung, also Ausdehnen der Lichtung entwickelt. In den Mittelgebirgen
ist das Miteinander von Wald und Wiese noch erlebbar. Und ich habe sogar
noch Kühe im Wald weiden gesehen, früher gab es auch die Eichelmast
der Schweine, heute Laubheu für manche Demeter-Kuh. Wiesen und Weiden
ermöglichen eine größere Vielfalt als Äcker, sie sind eben oft auf Standorten,
wo Ackern nicht geht. Die Weidenutzung ermöglicht dem Menschen auch
hier die Erzeugung von Nahrung. Die feuchten, nassen oder trockenen
und halbtrockenen Stellen bergen Lebensraum für zahlreiche Arten - Grünland
ist für den Naturschutz in der Regel interessanter als die Feldflur.
Doch ist auch auf den Wiesen nicht mehr alles im grünen Bereich. Als
ich neulich nachts mit der Bahn durch Niederbayern fuhr, kam ich mir
vor wie im Magen einer Kuh - obwohl die Fenster geschlossen waren. Intensive
Weidewirtschaft macht aus den wechselvollen Wiesen und Weiden Grasäcker,
für Erholung, Naturschutz und Landschaft uninteressant, im Extrem nicht
einmal tiergerecht. Gleichzeitig sinken die Milchpreise und Futter vom
Acker, Mais, wird höher prämiert als die Nutzung von Gras, Klee und
Kräutern. Da, wo die Menschen nicht mehr vom Grünland leben können,
breitet sich Gebüsch aus, fasst der Wald Fuß.
Diese Trends machen auch vor den Wiesen und Weiden im Ökolandbau nicht
halt. Noch schneiden diese hinsichtlich der Nachhaltigkkeit deutlich
besser ab als konventionelles Grünland (siehe Haas in LE 1-2002). Doch
sinkende Preise, zunehmend konventionelle Fütterungstechniken und überzüchtete
Kühe erzeugen auch hier Druck auf die Höfe.
Im Grünland stecken allerdings Reserven für den Ökobetrieb, die oft
- vor lauter Ackerbau und Feldgemüse - vernachlässigt werden. Darauf
will dieses Heft aufmerksam machen. Konsequente Fütterung, eigene Züchtung
und gründliche Grünlandwirtschaft können den Betriebserfolg verbessern,
wenn die Vermarktung stimmt.
Aber der Markt für tierische Ökolebensmittel, besonders Fleisch etc.
muss weitgehend noch auf- und ausgebaut werden, zuviel muss noch konventionell
vermarktet werden - schade drum. Und man muss den Preisvorteil für konventionelle
Futterpflanzen abbauen, z.B. mit einer entsprechenden Grünlandprämie.
Womit wir doch bei der Politik gelandet sind. Das Aktionsbündnis Ökolandbau
befragte am 31. August in Hannover die Parteien zum Ökolandbau. Ein
Resumee der schriftlichen Antworten vorab lesen Sie auf S. 5.
Ihr 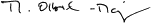
 Michael Olbrich-Majer Michael Olbrich-Majer
|