 |
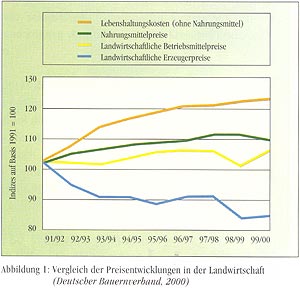 |
Preisentwicklung in der Landwirtschft
(DBV 2000)
|
Hauptsache billig - das hat Folgen
Lebensmittelindustrie und -handwerk sowie der Handel unterliegen ebenfalls
einem hohen Preisdruck. Konzentrationen und Aufkäufe gehen mit massivem
Preisdumping im konventionellen Lebensmittelhandel einher. Ein Beispiel
war der Einstieg von Walmart auf den deutschen Lebensmittelmarkt, wo
das Bundeskartellamt wegen zu niedriger Einstiegspreise einschritt und
diese untersagte. Die Unternehmen sind gezwungen, landwirtschaftliche
Rohstoffe bzw. Lebensmittel möglichst billig einzukaufen. In vielen
ausländischen Staaten, besonders in Süd- und Osteuropa sowie in Entwicklungsländern,
kann wegen der niedrigeren Löhne billiger produziert werden. Durch die
derzeit geringen Transportkosten sind die Preise für ausländische Rohstoffe
trotz der langen Wege meistens niedriger als für inländische. Diese
Konkurrenz drückt zusätzlich die Erlöse der heimischen Bauern und fördert
die Entstehung von Großbetrieben; die kleinen und mittleren müssen wachsen
oder weichen. In den letzten 50 Jahren haben allein in Deutschland über
eine Million von 1,65 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben ihre
Existenz aufgegeben, weniger als 300.000 Menschen leben im Hauptberuf
noch von der Landwirtschaft.
Konventionelle Lebensmittel sind vor allem deshalb so billig, weil sie
die ökologischen und sozialen Folgekosten ihrer Herstellung, Verarbeitung
und Vermarktung nicht enthalten. Durch das "Bauernhofsterben" müssen
z. B. arbeitslose Landwirte unterstützt werden. Die konventionelle Produktion
belastet zudem Wasser, Boden und Luft mit Schadstoffen, führt zu Erosion
und Verdichtung der Böden, begünstigt Artenschwund bei Pflanzen und
Tieren und verschlingt Energie und Rohstoffe. Die Beseitigung der Umweltschäden
muss ebenfalls die Gemeinschaft finanzieren. Hinzu kommen potenzielle
Gesundheitsgefahren für die Verbraucher, eine mögliche Schadstoffbelastung
der Lebensmittel beispielsweise mit Pestiziden, Nitraten und Tierarzneimitteln.
Manche Probleme wie Bodenerosion und Artenschwund werden weitgehend
auf künftige Generationen übertragen. Wenn es nach dem Verursacherprinzip
einen Preisaufschlag für die Folgekosten gäbe, wären die konventionellen
Erzeugnisse heute schon teurer als Lebensmittel aus ökologischer Produktionsweise.
| Ausgaben im Bedürfnisfeld Ausgaben relativ
(%) |
1962/63 |
1998 |
| Nachrichtenübermittlung |
0,6 |
2,5 |
| Gesundheitspflege |
1,2 |
3,8 |
| Wohnung, Energie, Wohnungsinstandsetzung |
15,8 |
32,8 |
| Verkehr |
7,2 |
13,7 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur |
7,3 |
11,8 |
| Bildungswesen |
0,5 |
0,6 |
| Beherbergungs- und Gaststättenleistungen |
4,7 |
4,8 |
| Innenausstattung, Haushalts- geräte und -gegenstände
|
9,8 |
6,8 |
| Bekleidung und Schuhe |
12,1 |
5,4 |
| Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren |
36,7 |
13,6 |
| Aufwendungen privater Haushalte für den
privaten Haushalt gesamt. (Früheres
Bundesgebiet, Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchstichproben,
Durchschnitt je Haushalt und Monat) Nach: Statistisches Bundesamt,
2000 |
Öko-Landwirte denken weiter
Der Zwang zur immer billigeren industriellen Produktion, Verarbeitung
und Vermarktung von Lebensmitteln ist immer häufiger der Nährboden für
Lebensmittelskandale. Schweinepest, Hormone und Antibiotika in Kalbfleisch,
Salmonellen und Dioxine in Geflügelfleisch und Eiern und aktuell Nitrofen
und Hormone im Tierfutter sind bekannte Auswüchse dieser Entwicklung.
Die immer noch schwelende BSE-Krise zeigt die Auswirkungen der Billig-Produktion
besonders drastisch.
In der ökologischen Landwirtschaft wird dagegen das Denken und Handeln
in Stoffkreisläufen groß geschrieben. So baut der Bio-Bauer neben Lebensmitteln
auch das Futter für das Vieh an und verwendet den Mist als Pflanzendünger.
Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass ökologische Landwirtschaft
die Umwelt eindeutig weniger belastet: Der Energieverbrauch liegt nur
bei der Hälfte der konventionellen Landwirtschaft, vor allem, weil keine
energieaufwändigen synthetischen Dünge- und Pflanzenbehandlungsmittel
nötig sind. Das trägt zu einem geringeren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase
bei, die für die Erwärmung der Erdatmosphäre verantwortlich sind. Auf
Grund der extensiven Viehhaltung wird zudem weniger Methan und Ammoniak
frei gesetzt. Weitere Vorteile: weniger Bodenerosion, geringere bzw.
keine Pestizidbelastung und eine deutlich niedrigere Nitratbelastung
der Böden sowie des Oberflächen- und Grundwassers und damit auch der
Lebensmittel.
Neben den ökologischen Vorteilen ist die Öko-Landwirtschaft auch sozialverträglicher.
Insbesondere in der hofeigenen Weiterverarbeitung und Direktvermarktung
der geernteten Lebensmittel werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Zusätzlich
bieten Öko-Lebensmittel gesundheitliche Vorteile, da sie weniger Rückstände
an Agrochemikalien enthalten. Über Geschmack lässt sich bekanntlich
streiten; dennoch ist für viele Menschen gerade der hohe Genussaspekt
ein wesentliches Argument für den Kauf von Erzeugnissen aus ökologischer
Landwirtschaft.
|
| |
 |
 |
| |
Mehr Aufwand - mehr Kosten
Öko-Bauern müssen einen höheren Arbeitsaufwand im Pflanzenbau und in
der Tierhaltung leisten und erzielen geringere Erträge als ihre konventionell
arbeitenden Kollegen. Folglich können die Verbraucherpreise für Öko-Lebensmittel
schon aus diesen Gründen nicht ebenso niedrig sein wie für konventionelle
Produkte.
Verbraucherbefragungen zeigen, dass die höheren Preise der Öko-Lebensmittel
für viele eine Kaufbarriere sind. In verschiedenen Umfragen geben Verbraucher
an, dass sie einen Mehrpreis bis zu 30% akzeptieren würden - tatsächlich
liegen ökologische Erzeugnisse jedoch mit durchschnittlich mehr als
50 % deutlich darüber. Während der Preisunterschied beim ohnehin teuren
Kalbfleisch nur sehr gering ausfällt (19 %), ist er bei dem billigen
Grundnahrungsmittel Kartoffel mit 116 % am höchsten.
Weiterhin beklagen die Kunden, dass Bio-Lebensmittel nicht dort angeboten
werden, wo sie sie gerne kaufen würden, z. B. in ihren gewohnten Geschäften.
Einige potenzielle Käufer sind auch durch zu viele Labels und Marken
verwirrt. Zweifel an der Echtheit von Öko-Produkten sind ein bedeutsamer
Hemmfaktor für ihren Kauf. Dabei gibt es seit Jahren ein flächendeckendes
und effektives Kontrollsystem. Hierzu gehören die Richtlinien der anerkannten
Anbauverbände und der Handelsorganisationen (eigene Warenzeichen), und
die EU-Öko-Verordnung. Das neue Bio-Siegel des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft kommt hinzu. Die umfangreichen
Kontrollen kosten Geld und belasten zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen
der Anbauverbände und den Lizenzgebühren zur Vermarktung zusätzlich
das Budget der Öko-Landwirte. Auch deshalb sind Bio-Produkte teurer,
denn dieser Anteil muss über den Verkauf der Lebensmittel aufgebracht
werden.
| Lebensmitel |
benötigte Arbeitszeit |
| |
1960 |
1999 |
| 250g Markenbutter |
39 min |
5 min |
| 1 l Vollmilch |
11 min |
3 min |
| 10 Eier |
46 min |
7 min |
| 1 kg Rindfleisch |
124 min |
30 min |
| 1 kg Brathähnchen |
133 min |
13 min |
| 250 g Bohnenkaffee |
46 min |
12 min |
| 1 kg Zucker |
30 min |
5 min |
| Die Kaufraft der Nettverdienste 1960 und 1999.
(Alte Bundesländer, Basis: Geschätzte
durchschnittliche Nettolohn- und -gehaltssumme je geleistete Arbeitsstunde:
1960: 2,49, 1999: 22,66) |
Mehr Nachfrage bringt geringere Preise
In Deutschland werden etwa 3,7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche
ökologisch bewirtschaftet. Andere europäische Länder sind hier schon
weiter, z.B. Österreich mit ca. 10% und die Schweiz mit rund 7 %. Um
den Absatz von Öko-Produkten zu steigern, sind neben den klassischen
Vermarktungsschienen wie Naturkostläden, Reformhäuser, Wochenmärkte,
Hofläden und Abo-Kisten auch neue Verkaufsstätten wie Bio-Supermärkte
und das Bio-Angebot im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel auszubauen.
Wenn immer mehr Menschen ökologisch erzeugte Lebensmittel nachfragen,
werden deren Preise infolge geringerer Erfassungs- und Verteilungskosten
sowie erhöhter Absatzmengen sinken mit der Gefahr, dass auch die Erlöse
der Bauern gedrückt werden.
Die Bundesregierung hat das Ziel, die ökologisch bewirtschafteten Flächen
in den nächsten 10 Jahren auf 20 % der Gesamtfläche auszuweiten. Dazu
sind jedoch die Rahmenbedingungen für den Öko-Landbau weiter zu verbessern.
Denn trotz der politischen Willenserklärung gibt es für Betriebe, die
auf Öko-Landbau umstellen wollen, zurzeit nur relativ geringe finanzielle
Hilfen. Dagegen fördern die Agrarausgleichszahlungen noch immer eine
Intensivierung der Landwirtschaft, besonders in konventionellen Großbetrieben.
Für den Öko-Landbau geben die EU-, Bundes- und Landesprogramme zusammen
deutlich weniger als 1 % des deutschen Beitrags an den Ausgleichszahlungen
aus. Die ökologischen Zusatzleistungen wie Schutz der Landschaft, der
Artenvielfalt und des Trinkwassers werden bis jetzt nicht angemessen
honoriert.
|