 |
 |
Lebendige Erde 2/2004:
Forschung
Innere Qualität: Entwurf eines neuen Qualitätsbegriffes
Parameter der Apfelqualität zwischen Wachstum, Differenzierung,
Integration
von Joke Bloksma
Dann hat er die Teile in der Hand
fehlt leider nur das geist´ge Band.
(Goethe, Faust)
Ein Qualitätsbegriff, bei dem das Aussehen und die Inhaltstoffe im
Vordergrund stehen, hat sich bei Produkten des ökologischen Landbaus
nicht bewährt. Biobauern und Konsumenten ökologischer Lebensmittel streben
eher ein Produkt an, dem „Ganzheit”, „Lebenskraft”, „Vitalität” und
„Gestaltzusammenhang” innewohnt. Landwirte wissen, dass für eine gute
Qualität ein nicht all zu hohes Produktionsniveau, eine mäßige Düngung,
sorgfältige Reifung sowie Frische eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund
des Preisdrucks auf landwirtschaftliche Produkte sind allerdings auch
Biobauern zunehmend darum bemüht, ihre Kosten zu senken – durch höhere
Erträge, mehr Düngung, frühere Ernte und die Nutzung von Handelsketten,
bei denen längere Transport- und Lagerzeiten anfallen.
.
|
| |

  

Wachstum oder Differenzierung? Das Ertragsniveau bzw. der Fruchtbehang
bestimmt, ob das Wachstum in den Baum oder in die Früchte geht und wie
viele Blätter da sind um eine Frucht zu ernähren
|
| |
.
Inwieweit diese Kostensenkung zu Lasten der Qualität der Erzeugnisse
geht, kann ohne ein einheitliches Qualitätskonzept nicht beurteilt werden.
Die internationale Forschungsvereinigung „Food Quality and Health” (FQH)1
hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Bedeutung von Zusammenhang, Struktur,
Reife und Produktqualität für den Geschmack und die Gesundheit des Verbrauchers
zu erforschen. In zwei Untersuchungen2, 3
an Äpfeln wurde ein umfassender Qualitätsbegriff mit überprüfbaren Parametern
entwickelt, der sowohl den Bedürfnissen ökologischer Produzenten als
auch dem der Konsumenten entspricht: die „Innere Qualität”. Erst nach
Einführung und Umschreibung dieses Begriffes und einer damit messbaren
Qualität ist es nach Meinung der ForscherInnen möglich zu prüfen, ob
Produkte mit einer hohen „Inneren Qualität” tatsächlich auch besser
schmecken und gesünder sind.
Ausarbeitung des Begriffes „Innere Qualität
Der anfänglich verwendete Begriff „Vitalität” erwies sich als nicht
ausreichend. Daher wurde diese Bezeichnung aufgegeben und der Oberbegriff
„Vitale Qualität” durch „Innere Qualität” ersetzt. Eine andere Schwierigkeit
bestand darin, für die Produkteigenschaften, die sich aus Wachstum,
Differenzierung und Integration ergeben, Bezeichnungen zu finden, die
sich auf alle Produkte anwenden lassen. „Struktur“ als Resultat von
Differenzierung und „Köhärenz“ als Resultat von Integration decken den
Begriff nicht vollständig für alle Produkte. Darum sprechen wir lieber
von den Produkteigenschaften des jeweiligen Produktes. Für Äpfel ist
zum Beispiel „groß und knackig” das Resultat relativ starker Wachstumsprozesse
und „süß und aromatisch” das Resultat relativ starker Differenzierungsprozesse.”
Im Laufe der Untersuchungen2, 3 wurde
außerdem deutlich, dass die beiden Lebensprozesse „Wachstum” und „Differenzierung”
alleine nicht genügen, um die innere Qualität von Lebensmitteln zu beschreiben.
Genau betrachtet ist der Unterschied zwischen diesen beiden Prozessen
lediglich ein begrifflicher. Denn sobald ein lebendiges Wesen anfängt,
sich zu entwickeln, tritt beides in einem bestimmten Verhältnis gleichzeitig
auf. Manchmal überwiegt das Wachstum (vegetative Lebensphase, Üppigkeit,
Krebsgeschwulst) und manchmal die Differenzierung (generative Lebensphase,
Notreife). Das Verhältnis und die Interaktion zwischen beidem wird von
unserer Forschergruppe als „Integration” bezeichnet. Zusammengenommen
sind diese drei Aspekte – Wachstum, Differenzierung und Integration
– die Basis der neuen Qualitätsbeurteilung, wobei im Wesentlichen die
Integrationsprozesse die Ausprägung der Qualität beeinflussen.
Darüberhinaus soll der neue Qualitätsbegriff die unterschiedlichen
Vorstellungen von Produzenten und Konsumenten berücksichtigen. Während
für den Produzenten die wachsende Pflanze mit ihren Lebensprozessen
– die er fördern, hemmen und ins Gleichgewicht bringen kann – im Vordergrund
steht, sind für die Konsumenten und den Handel die Eigenschaften des
Endproduktes, die kontrollierbar und erkennbar sein sollen, entscheidend.
Der Qualitätsbegriff hat darum zwei Seiten: die Produkteigenschaften
und den Produktionsprozess. Der Landwirt kann in Letzteren lenkend eingreifen,
um die Qualität des Endproduktes zu optimieren. Die schematische Darstellung
des Begriffes „Innere Qualität” (s. Tabelle) enthält daher drei Spalten,
in denen Kulturmaßnahmen, Lebensprozesse und Produkteigenschaften in
Zusammenhang gebracht werden. Dem Begriff Integration entspricht dabei
auf der Endproduktseite der Begriff Kohärenz. Dieser neu bestimmte Qualitätsbegriff
wurde mit einer Reihe von Hypothesen und Ergebnissen aus der Literatur
verglichen, um die Konsistenz des theoretischen Konstrukts zu prüfen.
Der Begriff lässt sich zum Beispiel gut mit der Growth-Differentiation-Balance-Hypothese
aus der pflanzenökologischen Forschung über den Widerstand gegen Krankheiten
und Schädlinge verknüpfen – ein Hinweis auf die Validität. Für den Begriff
der Integration muss die Literaturuntersuchung noch weiter fortgesetzt
werden. Die Einführung eines neuen Qualitätsbegriffs mit experimentellen
Parametern – zur Prüfung der Vorhersagevalidität nötig – bringt die
Gefahr von Zirkelschlüssen mit sich. Ein unbekannter Begriff, in diesem
Fall Integration, lässt sich schließlich schlecht mit Hilfe unzureichend
erforschter Kulturmaßnahmen (biologisch-dynamische Präparate) einführen
oder anhand von experimentellen Parametern, wie z.B. Kupferkristallisation,
messen. Korrelieren experimentelle mit bekannten Parametern, z.B. Widerstand
gegen Krankheiten und als optimal bewerteter Geschmack, liegt eine Konvergenzvalidität
vor, man kann mit dem kostengünstigsten Parameter weiter arbeiten. Lassen
sich keine Korrelationen finden, kann dies ein Hinweis auf neue Qualitätsaspekte
sein.
.
|
| |
Versuchsaufbau:
4 Wiederholungen, davon 2 mit bd Präparaten; insgesamt 6 Düngungsvarianten,
zehn Bäume umfassend: ungedüngt, 4 Niveaus Handelsdünger, 1 mal bd Kompost.
Zur Beurteilung wurden standardisierte Früchte (70-90mm groß) aus mittlerer
Höhe, sonnig bis halbschattig, entnommen. |
 |
 |
| |
 |
 |
Welchen Einfluss haben Reife, Ertrag, Sonnenlicht
und Wachstum auf die Qualität von Äpfeln? Apfelernte der Versuchsvarianten
|
Parameter der Apfelqualität
Bei der ersten Untersuchung2 mit Äpfeln (Sorte Elstar) unterschieden
sich die Varianten jeweils in nur einem der folgenden Faktoren: Erntezeitpunkt,
Ertrag, Sonneneinstrahlung oder Alterung nach der Lagerung. In der zweiten
Versuchsreihe3 wurden dreijährige Varianten hinzugefügt, um den Begriff
der Integration weiter herauszuarbeiten. Dazu wurden unterschiedliche
Düngungsstufen und -arten, kombiniert mit den biologisch-dynamischen
Präparaten, miteinander verglichen. Untersucht wurden neben herkömmlichen
Parametern (wie Triebwachstum, Ertrag, Krankheiten, Schäd-linge, Inhaltsstoffe
der Früchte, Farbe, Festigkeit und Geschmack) auch experimentelle Parameter
(wie Selbstzersetzungstest, Kupferchloridkristallisation, Steigbilder,
Lumineszenz und elektrochemische Parameter).
Auswirkungen des Erntetermins auf den Reifungsprozess
Eine Behandlungsvariante wurde jeweils an verschiedenen Terminen geerntet,
um den Unterschied zwischen Reifung am Baum und Reifung bei Lagerung
zu untersuchen. Dabei zeigte sich, dass die Umwandlung von Stärke zu
Zucker und der Verlust von Festigkeit sowohl am Baum als auch bei der
Lagerung ähnlich verlaufen. Für viele andere Aspekte, wie z.B. für Farbe,
Größe und Aroma, ist die Reifung am Baum jedoch essentiell. Auch bei
den Parametern Lumineszenz, Kristallisationsbild und Steigbild wurde
eine schlechtere Reifung durch zu frühe Ernte festgestellt. Bei der
Reifung am Baum zeigten die bildschaffenden Methoden eine Zunahme von
Offenheit und waren stärker nach Außen gerichtet. Ein ähnliches Bild
ergibt sich im Reifungsprozess im Lager, bei dem eine aufeinanderfolgende
Umwandlung von festen Stoffen in die flüssige oder gasförmige Zustandsform
beobachtet wird. Harte Früchte mit Stärke, Säuren und Phenolen, werden
in saftige Früchte mit aufgelösten Zuckern und Aromastoffen umgewandelt.
Zu hohe Erträge – aber auch zu niedrige – vermindern
die Qualität
Durch eine abgestufte Ausdünnung der Früchte pro Baum wurden fünf verschieden
hohe Erntemengen pro Hektar simuliert. Die mittleren Ertragsniveaus
erwiesen sich für Geschmack, Haltbarkeit und Blütenknospenformung als
optimal. Ein bekanntes Phänomen, das sich auch hier zeigte, ist der
Zusammenhang zwischen höherem Ertrag und geringerem Wachstum der Äste,
zu niedrigem Blatt/Frucht-Verhältnis und geringerem Knospenansatz für
das nächste Jahr. Auch für die Qualitätsparameter, die mit Assimilation
und Aufnahme der Mineralien zu tun haben, konnten niedrigere Werte bei
maximierten Erträgen festgestellt werden, z.B. für Trockenmasse, Zucker,
Säuren, Aromen und Mineralien. Diese Wachstumsprodukte verteilen sich
dann auf mehr Früchte. Nur der Kalziumgehalt zeigte auch beim höchsten
Ertrag noch eine steigende Konzentration. Die Kristallisationsbilder
zeigten bei niedrigen Ertragsniveaus ein Bild von Kraftlosigkeit und
entsprachen eher einem vegetativen Stadium; beim höchsten Ertragsniveau
waren sie verkümmert, besaßen aber schärfere Formen. Nur bei den mittelmäßigen
Erträgen waren meistens vitale und differenzierte Bilder zu sehen. Die
Steigbilder wurden mit zunehmendem Ertrag schärfer ausdifferenziert.
Der Geschmack zeigte kaum Unterschiede, verschlechterte sich aber bei
dem höchsten Ertrag geringfügig. Bei der Lumineszenz nahm das Niveau
gerade nach der Anregung ab und die „Hyperbolizität” nahm zu. Zusammenfassend
muss gesagt werden, dass mit zunehmendem Ertrag eine Abnahme an Wachstumsmerkmalen
und eine Zunahme an Struktur (Differenzierung) zu beobachten war.
|
| |

 
 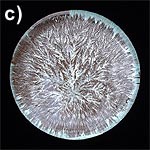
Ertrag und Qualität: Die verschieden hohen Ertragsniveaus führen
zu unterschiedlich ausgestalteten Kristallisationsbildern: a) 14 t/ha
Ertragsniveau: Kraftlosigkeit, vegetative Formen b) 40 t/ha Ertragsniveau:
optimale Kraft und Struktur, apfeltypisch c) 56 t/ha Ertragsniveau:
verkümmerte, scharfe Formen
|
| |
Sonnenlicht sorgt für Gleichgewicht
Die Wirkung des Sonnenlichts wurde in drei verschiedenen Intensitäten
(volle Sonneneinstrahlung, totaler Schatten und Mischform) untersucht.
Die Serie mit voller Sonneneinstrahlung zeigte eine bessere Färbung, höhere
Gehalte an Phenolen, ein breiteres Farbenspektrum der Lumineszenz, mehr
Einheitlichkeit und Transparenz im Kristallbild sowie rundere, offenere
Formen im Steigbild, alles ein Maß für mehr Integration. Überraschend
war, dass kein Unterschied in Geschmack, Festigkeit, Kalzium- oder im
Säuregehalt gefunden wurde. Dennoch hatten die Früchte, die im Schatten
gewachsen waren, viel höhere Gehalte an N, P, K und Aminosäuren. Die sonnenbeschienenen
Äpfel besaßen dafür ein höheres Ca/K-Verhältnis und ein höheres Verhältnis
von Eiweiß- zu Gesamt-N, was zu einer verbesserten Haltbarkeit führt.
Sonneneinstrahlung scheint die Differenzierung zu stimulieren, wodurch
mehr Struktur und Kohärenz entsteht. Die Lichtserie wurde mit einer Präparateserie
kombiniert, da von den Präparaten ähnliche Effekte wie vom Sonnenlicht
erwartet wurden. Aufgrund von Bodenunterschieden lassen die Ergebnisse
aus dieser Untersuchung jedoch keine gesicherten Schlussfolgerungen zu.
|
| |
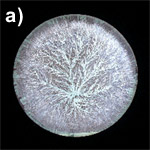 

Reifequalität ist etwas lebendiges: Die Kristallisations-bilder
zeigen bei der Reife am Baum (a) eine Zunahme von Offenheit und sind
stärker nach außen gerichtet im Ver-gleich zur Lagerung (b)
|
| |
Alterung im Lager
Die Äpfel des mittleren Erntetermins wurden drei Monate lang bei kühlen
Temperaturen gelagert und zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus dem Lager
geholt. So entstand eine Serie von Äpfeln, die unterschiedlich , ein
bis zwölf Tage lang, gealtert waren. Wie zu erwarten, nahmen mit zunehmender
Alterung die Festigkeit und der Gehalt an Säuren deutlich ab, während
der Zuckergehalt durch die Remobilisierung noch eine Weile konstant
blieb. Fast alle untersuchten Parameter zeigten, selbst nach zwölf Tagen,
nur eine begrenzte Alterung. Daher war diese Serie, aufgrund der zu
geringen Lagerungszeit, nicht ausreichend aussagekräftig und für die
Prüfung des Qualitätsbegriffes nicht geeignet. Bemerkenswert war jedoch,
dass die Äpfel, die erst seit einem Tag nicht mehr gekühlt wurden, bei
vielen Parametern weniger gute Werte hatten als die Äpfel, die vier
Tage zuvor aus dem Kühlhaus geholt wurden. Es scheint, als ob sich die
Äpfel erst an die Bedingungen außerhalb der Kühlung anpassen müssen.
Effekte der Düngung und Präparate auf die Qualitätsparameter
Im Rahmen der zweiten Untersuchung wurde in vier Wiederholungen überprüft,
ob die Höhe der Düngung, die Düngungsart und der Einsatz der biologisch-dynamischen
Präparate Einfluss auf das Verhältnis zwischen Wachstum und Differenzierung,
also auf die Integration haben. Eine Kombination zweier Handelsdünger
(Abfallprodukte aus der Zucker- und Bierproduktion sowie granulierter
biologischer Hühnermist) wurde in fünf verschiedenen Düngungsintensitäten,
von null bis 160 kg N/ha eingesetzt. Zusätzlich wurde eine Variante
mit halb verrottetem Kompost (mit 100 kg N/ha) eingerichtet. Nach etwa
drei Versuchsjahren wurde deutlich, dass auf dem Versuchsstandort eine
Düngermenge von null und 40 kg N/ha eindeutig zu wenig war (die Bäume
alternierten), während 160 kg N/ha zu viel war (schlechte Fruchtqualität).
Die zunehmende Düngung äußerte sich in einer stärkeren Ausprägung der
Wachstumsmerkmale und einer Abnahme der Differenzierungsmerkmale: Länger
anhaltendes Triebwachstum (dadurch auch mehr Schimmelkrankheiten), dunklere
und größere Blätter, höherer Stickstoffgehalt, stärkere Blütenknospenbildung.
Die Äpfel waren größer, weniger fest etwas weniger sauer und wiesen
einen niedrigeren Phenolgehalt, mehr Fruchtfäule und weniger Rotbackigkeit
auf. Die mittlere Düngermenge von 100 kg N/ha erwies sich bei dieser
Parzelle als optimal. Die Verwendung von Kompost gegenüber Handelsdünger
brachte in Bezug auf den Boden klare Vorteile: Mehr Bodenleben, schnellere
Laubzersetzung und weniger Schorfüberwinterung im Boden. In den ersten
beiden Versuchsjahren zeigte sich, dass die Baum- und Fruchteigenschaften
bei der Kompostanwendung mit denen der ungedüngten Felder zu vergleichen
waren. Nach dreijähriger Kompostanwendung entsprachen die Ergebnisse
jedoch denen der mittelhohen Handelsdüngung. Die Nährstoffe im Kompost
kommen somit in höherem Maße dem Aufbau der Bodenfruchtbarkeit zugute;
beim Handelsdünger hingegen unmittelbar dem Baum. Darüber hinaus konnten
keine Hinweise auf eine verbessere Integration durch Kompost festgestellt
werden.
Der Einfluss der biologisch-dynamischen Spritzpräparate war in diesem
Versuch schwer zu anzusichern, da wegen der großen Behandlungsflächen
(33 x 50 m) die Varianten nur zweifach wiederholt wurden. Die meisten
Unterschiede durch Präparate waren kleiner als die bodenbedingten Unterschiede.
Kritisch zu beurteilen ist auch, dass nur 10 m Pufferabstand eingehalten
und die Flächen ohne Präparateanwendung vor dem Versuch lange biologisch-dynamisch
bewirtschaftet wurden.
.
|
| |
|
Innere Qualität bei Äpfeln
|
| Kulturmaßnahmen |
Prozesse im Baum |
Eigenschaften im Endprodukt |
|
1 Wachstum
|
|
Keine Beschränkung in Düngung und Wasserversorgung
Fruchtausdünnung
Wachstumsfördernden Schnitt
Weiter Pflanzenabstand
|
Massebildung
Bildung von primären Pflanzenstoffen
durch die Photosynthese
Füllen der Reserveorgane mit Eiweiß,
Stärke usw.
Erhaltung
|
Grüne vegetative Masse, Größe und Ertrag
Zucker, Säuren, Stärke, Aminosäuren und
Eiweiß
Saftigkeit, Knusprigkeit
metabolische Energie
Pilzkrankheiten und saugende Insekten
(Blattläuse)
|
| |
2 Differenzierung |
(Struktur) |
|
Wärme, Licht und Standort
Wachstumsbegrenzung
Ausbiegen Junger Zweige
Hormon Ethylen
|
Reifung (aus Stärke wird Zucker, aus
Säure wird Aroma)
Anlage von Blütenknospen, Pollen und
Samen (generative Organe)
|
Differenzierte feine Formen
Ordung
Kalzium, kräftige Zellwände
Reife bzw. Notreife
Ethylen (Reifungshormon)
Beißende Insekten, Echter Mehltau
|
| |
1+2 Integration |
(Kohärenz) |
|
Art- und entwickungsphasengemäße Versorgung
der Proportion von Wachstum und Differenzierung
Gleichgewicht und „Slow Release“
Angepasste Sortenwahl
Menschliche Zuwendung?
Harmonische Landschaft?
Biologisch-dynamische Präparate?
|
Art- und entwickungsphasengemäße Proportion
von Wachstum und Differenzierung
Interaktion zwischen Wachstum und Differenzierung
Bildung von sekundären Pflanzenstoffen
aus primären
Selbstregulation
|
Schmackhafte, glänzende, rote, feste
und saftige Früchte
Resistenz gegen Selbstzersetzung
lastizität, Resistenz gegen Stress und
Krankheit, Wundheilung
Phenole, Vitamin C, Wachs, Harz
Höherer Eiweißanteil am Gesamtstickstoffgehalt
Art- und Betriebstypisch
Viele fruchtbare generative Organe (Samen,
Blütenknospen)
|
|
| |
Integration als Maßstab für Qualität des Erzeugungsprozesses
Es gibt Parameter, die das Vermögen besitzen, etwas über das Ausmaß
der Integration auszusagen. Dies sind die Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten und Schädlinge, der Gesamtgeschmack, Phenole, das Verhältnis
zwischen Eiweiß und freien Aminosäuren, Integrationsindikatoren in Kristallisationsbildern
und produktspezifische Spektralverteilung der Lumineszenz (nach Kwalis).
Die ersten drei stellen allgemein akzeptierte Messmethoden dar; die
letzten drei sind kürzlich für Möhren und Weizen validierte Messmethoden.
Aus den gewonnenen Ergebnissen und den hier verwendeten Messmethoden
lässt sich jedoch noch kein eindeutiges Qualitätsurteil ableiten. Dazu
ist ein Qualitätsbegriff erforderlich, innerhalb dessen diese Messmethoden
ihre Bedeutung haben, und weitere Vergleichsreihen mit anderen Produkten.
Die Kupferchloridkristallisationen und die Spektralverteilung der Lumineszenz
lassen sich gut in den von uns formulierten Qualitätsbegriff einpassen,
da beide Techniken in Bezug auf alle drei Aspekte, Wachstum, Differenzierung
und Integration, beurteilt werden können. In dieser Untersuchung, die
vor allem eine gelungene Wachstumsserie erbracht hat, konnte für beide
Techniken tatsächlich eine Korrelation für den Wachstumsaspekt mit vielen
allgemein akzeptierten Wachstumsparametern festgestellt werden. Bei
den elektrochemischen Messungen haben wir in dieser Untersuchung eine
zu große Variation feststellen müssen, um auf Unterschiede zwischen
den Behandlungen schließen zu können.
Empfehlungen für weitere Untersuchungen
Der nächste Schritt zur Validierung des Qualitätsbegriffes ist die pflanzenphysiologische
Untermauerung des Begriffs „Integration” mit den dazugehörigen Kulturmaßnahmen.
Anschließend können weitere Versuche zum Thema Integration mit Äpfeln
und anderen Gewächsen geplant und durchgeführt werden (das Louis Bolk
Institut plant bereits eine Versuchsreihe mit Möhren). Außerdem muss
eine Einordnung der „Inneren Qualität” mit Bezug auf andere Qualitätsbegriffe
erfolgen und eine Verbindung hergestellt werden zur Gesundheit von Mensch
und Tier. Diese sollte auf einer ganzheitlichen Gesundheitskonzeption
basieren und der Gesundheitsforschung vorausgehen.
.
|
| |
1 Beteiligte Institutionen:
Obstgarten Boomgaard ter Linde in Oostkapelle (NL), Kwalis Qualitätsforschung
Fulda (D), Meluna Biofotonen-onderzoek in Geldermalsen (NL), Elektro-chemisches
Qualitätslabor, Weidenbach (D), Biodynamic Research Association Dänemark
(DK) sowie das Louis Bolk Instituut in Driebergen (NL). Das Projekt wurde
finanziell ermöglicht von Boomgaard ter Linde (NL), Stichting Triodos
Fonds (NL), Rabobank (NL), Software AG Stiftung (D), Zukunftsstiftung
Landwirtschaft (D), Meluna (NL), Kwalis Qualitätsforschung (D) und dem
internen Projektfonds des Louis Bolk Instituuts (NL).
2 Joke Bloksma, Martin Northolt, Machteld Huber (2001): Parameters
for Apple Quality and an outline for a new Quality Concept, Louis Bolk
Instituut, Publ.-Nr: FQH-01 (mit deutscher Zusammenfassung) ISBN 90-74021-22-0
3 Joke Bloksma, Martin Northolt, Machteld Huber, Pierterjans Jansonius,
Marleen Zanen (2004): Parameters for Apple Quality and the development
of the Inner Quality Concept, Louis Bolk Instituut, Publ.-Nr: FQH-03,
(mit deutscher Zusammenfassung) ISBN 90-74021-33-6
Ebenfalls empfehlenswert: ‘Life processes in crops’ Louis Bolk
Instituut, Publ.-Nr. FQH-02 –E, , Tel. ++31-343-523860, www.louisbolk.nl
|
| |
Joke Bloksma u.a.,
Louis Bolk Instituut,
Hoofdstraat 24,
NL3972 LA Driebergen,
www.loouisbolk.nl
deutsche Überarbeitung und Zusammenfassung: Nora Mannhardt
|