Lebendige Erde 2/2005:ForschungMit Planetenkonstellationen züchten?
|
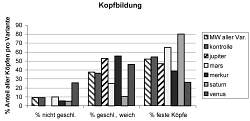 Die Varianten unterscheiden sich im Anteil an nicht geschlossenen, an geschlossenen, aber weichen und an festen Köpfen |
Solche Ergebnisse können für die Züchtung nur dann eine Bedeutung haben, wenn Pflanze und Umwelt als Ganzheit aufgefasst werden. Die Züchtungsforschung für den biologisch-dynamischen Landbau geht von dieser Grundlage aus. Im Zentrum der Erkenntnisbemühungen steht das Beziehungsgefüge zwischen Pflanze und Umgebung, Ziel der züchterischen Arbeit ist, dieses mitzugestalten (Kunz und Karutz 1991). Genau umgekehrt kann die neuere Entwicklung in der konventionellen Züchtung skizziert werden: Wissen über die Pflanze wird fern der natürlichen Umgebung im Labor gewonnen, Züchtungsziel ist die Vereinheitlichung optimierter Ertragseigenschaften bezogen auf Umgebungen, deren modifizierende Einflüsse über Düngung und Kulturführung minimiert werden sollen.
|
Der Einfluss von Planetenkonstellationen auf das Pflanzenwachstum als Forschungsfrage
Ob bestimmte Planetenkonstellationen bei der Aussaat der Mutterpflanzen sich in den folgenden Generationen spezifisch auswirken, ist eine der Fragen, die im Verein biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter, Kultursaat e.V., bearbeitet werden. Seit den Anfängen des biologisch-dynamischen Landbaus sind zahlreiche Untersuchungen über die Wirkungen planetarer Konstellationen auf das Pflanzenwachstum durchgeführt worden. Ihre Ergebnisse - insbesondere diejenigen von Thun (1963 ff.) - wurden zum Teil mehrfach auf ihre Reproduzierbarkeit überprüft (Abele 1973,75, Graf 1977, Lücke 1982, Spieß 1994) und werden bis heute kontrovers diskutiert (Kollerstrom und Staudenmaier 1998, 2001, Spieß 1998). Die Untersuchungen von Spieß (1994) belegen Herkunftswirkungen aufgrund des Saatzeitpunktes, die unter bestimmten Umständen in agronomisch relevanten Größenordnungen liegen können. |
|
Kopfsalat und Mond-Planetentrigone - neutraler Nachbau im morphologischen Test
2003 wurde ein Nachbau der sechs separat geernteten Varianten unter einheitlichen Bedingungen durchgeführt. Untersucht wurde, ob sich der Aussaatzeitpunkt der Mutterpflanzen in morphologischen Eigenschaften wie Entwicklungsdynamik, Kopfbildung, Krankheitsanfälligkeit, Blattreihen und Geschmack bei den Nachkommen unterschiedlich auswirkte. Diese Parameter wurden an je 20 Pflanzen pro Variante durch regelmässige Bonituren und in drei Verkostungen ermittelt. Die Blattreihen wurden fotografiert und digitalisiert. Verschiedene Parameter (Flächen, Längs- und Breitachsen flächengleicher Ellipsen, etc.) wurden berechnet und statistisch analysiert. Die zeitlichen Verschiebungen der Entwicklung während Kopfbildung und Schossen, der Anteil an festen bzw. marktfähigen Köpfen, sowie die Dichte des Blattansatzes (Abb. 2) geben einen direkten Eindruck von unterschiedlichen Tendenzen zwischen den Varianten. Für die Blattreihen wurden die letzten zehn Blätter vor der terminalen Blüte des Haupttriebes geerntet. Dieser kleine Abschnitt aus dem gesamten Wachstumsgeschehen gibt lediglich einen Hinweis auf das mehr oder weniger ausgeprägte Verbleiben der vegetativen Kraft im Haupttrieb nach Einsetzen des Blühimpulses.
Entsprechend des Vorversuchscharakters dieser Arbeit wurden nur Tendenzen zwischen den Varianten herausgeschält, die durch Wiederholungen unter verschiedenen Bedingungen, mit größeren Probenzahlen, vor allem über mehrere Vegetationsperioden zu prüfen wären. Die Aussagen zur Kopfbildung sind in Abb.1, diejenigen zu den Blattflächen in Abb. 2 grafisch zusammengefasst. |
|
Ergebnis: unterschiedliche Charakterisierung der Varianten
|
|
Fazit und Diskussion
Die Charakterisierung der Varianten zeigt, dass im einheitlichen Nachbau morphologische Unterschiede auftraten. Da bei Kopfsalat von einer Selbstbestäubungsrate von 95% ausgegangen werden kann, ist ein modifizierender Einfluss des Aussaattermines anzunehmen. Solche Wirkungen werden auch von anderen Züchtern bestätigt (Spieß 1990, 1994, von Brook 1990, Heyden 2003, Henatsch 2004, Kunz 1990). Bockemühl (1980) bezeichnet sie als eine Art "Erinnerung" an die jahreszeitlichen Bedingungen, in denen die Mutterpflanze aufgewachsen ist.
In den zitierten Arbeiten wurden verschiedene Faktoren untersucht, die bei variiertem vorjährigem Aussaattermin Modifikationen im neutralen Nachbau auslösten. Neben lunaren Rhythmen (z.B. Beeinflussung des Keimverhaltens bei Aussaat vor Vollmond), die in den Ergebnissen von Spieß belegt sind, kommen jahreszeitliche und klimatische Unterschiede bei verschiedenen Aussaatterminen in Frage, auch wenn diese nur innerhalb von 10 Tagen variieren. Auf mechanischer Ebene kann z.B. wetterbedingte Bodenverdichtung während der Bearbeitung, auf physiologischer Ebene die Dynamik der Nährstoffverfügbarkeit- insbesondere der labilen Stickstoffverbindungen bei unterschiedlichen Temperaturen - die gesamten Aufwuchsbedingungen nachhaltig beeinflussen. Alle diese Faktoren kommen in diesem Versuch zusätzlich zu der intendierten Beeinflussung durch Mond-Planeten-Trigonstellungen als Auslöser für die festgestellten Modifikationen in Betracht und sind im Freiland kaum gegeneinander abzugrenzen. Auch kann die Wetterlage Ausdruck der aktuellen Konstellation sein. Im Prinzip sind sie nur unter konstanten Umweltbedingungen (Klimakammern) auszuschließen. |
Vererbung neu denken und erforschen?
Rudolf Steiners Auffassung von Vererbung lässt beide Interpretationen zu und kann züchterische Bemühungen in dieser Richtung ermutigen: "Neue Formen können nur durch eine Veränderung dieser Umstände (damit sind aktuelle Umgebungsbedingungen gemeint, Anm. d. Verf.) bewirkt werden..." und "... Gewisse einmal angenommene Merkmale werden noch in den fernsten Nachkommen bemerkbar sein..." Aber Steiner weist auch darauf hin, dass "...diese neuen Umstände ... auch mit den schon entstandenen Formen zu rechnen haben, denen sie gegenübertreten..." (Steiner 1989, 1891). Er betont immer wieder, dass die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft ernst zu nehmen sind, da sie zu neuen Fragestellungen führen (Steiner 1984,1921). In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die jüngsten Erkenntnisse der Genetik sich im Sinne eines Paradigmenwechsels von der Auffassung der Pflanze als "Baukasten" zum Primat eines ganzheitlichen Organismusverständnisses lesen lassen (Wirz 2000).
Beispielsweise wurde gezeigt, dass über Samen vererbte Eigenschaften nicht nur durch Veränderungen im Genom (Mutationen), sondern auch über strukturelle Veränderungen der Chromosomen (epigenetische Effekte) zustande kommen können (Gibbs 2003). Diese epigenetischen Veränderungen können an Folgegenerationen weitergegeben, aber prinzipiell auch wieder aufgehoben werden. Aufgrund der heutigen Kenntnisse der Vererbung bei Pflanzen kann angenommen werden, dass es sich bei den oben beschriebenen phänotypischen Modifikationen nicht um Mutationen im klassischen Sinn handelt, sondern dass sie möglicherweise auf epigenetischer Ebene eine Erklärung finden. |
Kurz & knapp
|
Quellen
|